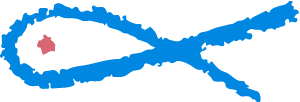Vinzenz-Gemeinschaft – Ort der Barmherzigkeit
August 5, 2025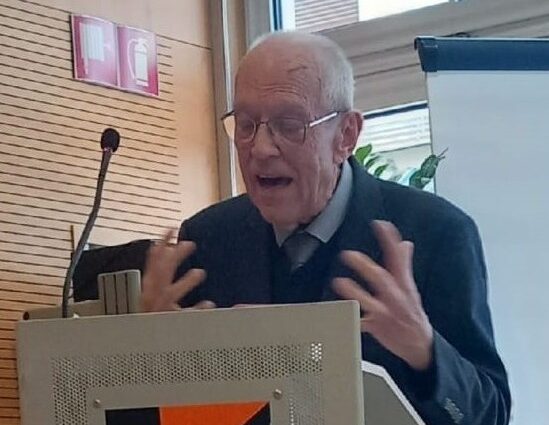
1. Einleitung
1.1 Die beiden Inhalte Vinzenz-Gemeinschaft und Barmherzigkeit sind in sich schon eng verbunden. Für diese enge Verbindung bürgt die Person des hl. Vinzenz von Paul, auf die Name und Tätigkeit der Vinzenz Gemeinschaften bezogen sind. Vinzenz von Paul war der französische Geistliche, der in den Jahrzehnten um 1600 nach einer längeren Entwicklung zum großen Nothelfer der Kranken und Armen geworden ist. Man denke nur an das Wort, das er den Frauen, die sich zur Gemeinschaft der „Töchter der christlichen Liebe“ zusammengeschlossen haben, mit auf den Weg gab:
„Ihr habt als Kloster die Häuser der Kranken, als Zelle eine Mietkammer, als Kapelle die Pfarrkirche, als Kreuzgang die Straßen der Stadt…“
Zu Recht gilt Vinzenz von Paul, der am 27. September 1660 in Paris starb, auf Grund seines Wirkens auf dem Gebiet der Armenfürsorge und Krankenpflege als Begründer der neuzeitlichen Caritas. So ist sein Name nicht zu trennen von dem, was „Barmherzigkeit“ meint.
1.2 Das Wort „Barmherzigkeit“ stammt eigentlich aus einer Umbildung des althochdeutschen armherz(ig), das sich herleitet aus dem gotischen armahairts, das wiederum sich auf das lateinische misericors (jemand, der ein cor d.h. Herz für die miseri d.h. die Unglücklichen hat) sich bezieht.
In der Bibel gehört „Barmherzigkeit“ zu den zentralen Begriffen der Rede von Gott und Menschen: Aus Barmherzigkeit handelt Gott an den Menschen in Barmherzigkeit; der Mensch antwortet darauf, indem er die selbst erfahrene göttliche Barmherzigkeit wiederum durch barmherziges Handeln weitergibt.
Wo Israel am intensivsten zum Ausdruck bringt, was Gott ihm bedeutet, lässt es Gott selber von sich sagen:
Ex 34,6f Der HERR ging vor seinem Angesicht vorüber und rief:
Der HERR ist der HERR, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich an Huld und Treue: Er bewahrt tausend Generationen Huld, nimmt Schuld, Frevel und Sünde weg, aber er spricht nicht einfach frei, er sucht die Schuld der Väter bei den Söhnen und Enkeln heim, bis zur dritten und vierten Generation.
Damit begründet das glaubende Israel die Vorordnung der göttlichen Barmherzigkeit vor dessen Gerechtigkeit. Qualifiziert ist diese Barmherzigkeit, durch Treue und Verlässlichkeit, die dem Menschen von Gott zukommt.
Das hebräische Wort ræḥæm (=Mutterleib, Eingeweide, Erbarmen) für „Barmherzigkeit“ bezeichnet den Raum, wo gerade der Mensch bzw. alle Lebewesen in der verletzlichsten Phase des Lebens aufgehoben sind und verweist darauf, dass Barmherzigkeit den Ort umschreibt, wo die Verletzten, Ärmsten, an den Rand Gedrängten geborgen sind.
2. Jesus – Manifestation der Barmherzigkeit Gottes
Wenn „Barmherzigkeit“ für das alte Israel so eng mit seiner Gotteser-fahrung verbunden ist, dann verwundert es nicht, dass die Jesus-Gemeinden – die Evangelien als Glaubenszeugnis dieser Gemeinden bekunden es – Jesus als die Manifestation der Barmherzigkeit Gottes verkünden. Man könnte dies durch das gesamte Neue Testament hindurch verfolgen. Hier genügt der Hinweis, wie der Evangelist Lukas – sein Evangelium gilt in besonderer Weise als das Evangelium, die gute Botschaft Jesu für die Armen – programmatisch den Beginn und damit das Gesamt des Auftretens Jesu mit der Botschaft von Gottes Barmherzigkeit verbindet:
Lk 4,14-21: Jesus kehrte, erfüllt von der Kraft des Geistes, nach Galiläa zurück. Und die Kunde von ihm verbreitete sich in der ganzen Gegend. …
So kam er auch nach Nazaret, wo er aufgewachsen war, und ging, wie gewohnt, am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um vorzulesen,
reichte man ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er öffnete sie und fand die Stelle, wo geschrieben steht:
Der Geist des Herrn ruht auf mir; denn er hat mich gesalbt.
Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe;
damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht; damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe.
Dann schloss er die Buchrolle, gab sie dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er, ihnen darzulegen: Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt.
Dementsprechend erzählt das Lukas-Evangelium immer wieder, wie Jesus sich gerade denen zuwendet, die die Gesellschaft ausschließt und meidet.
Als markantes Beispiel, wie Jesus gerade für die offen ist, die es besonders brauchen, gelte Lk 5,27-32:
Danach ging Jesus hinaus und sah einen Zöllner namens Levi am Zoll sitzen und sagte zu ihm: Folge mir nach! Da verließ Levi alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi gab für Jesus in seinem Haus ein großes Gastmahl. Viele Zöllner und andere waren mit ihnen zu Tisch. Da murrten die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten und sagten zu seinen Jüngern: Wie könnt ihr zusammen mit Zöllnern und Sündern essen und trinken? Jesus antwortete ihnen: Nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte, sondern Sünder zur Umkehr zu rufen.
3. Die Gemeinden Jesu als Erscheinung dieses Jesus in einer Welt voller Gegensätze und Nöten aller Art
Die Gemeinden in der Gefolgschaft Jesu haben nicht nur Jesus als das konkret erfahrbare Erscheinen der Barmherzigkeit Gottes bekannt, sondern sie waren überzeugt, dass das Erfahrbar-Machen der Barmherzigkeit Gottes durch Jesus auch das Gesicht und das Verhalten der Gemeinden prägen muss, die sich als Gemeinden Jesu, als seine Kirche verstehen.
Die Situation der Lukas-Gemeinden ist bestimmt durch die wirtschaftlich-soziale Strukturierung der antiken Gesellschaften des Mittelmeerraumes im 1. Jh. n. Chr., die eine starke Schichtung aufwiesen: Es gibt eine schmale Oberschicht der herrschenden Elite (ca. 10% der Gesamtgesellschaft), die ca. 1% wirklich Reiche aufwies, meist aristokratische Großgrundbesitzer, deren Einnahmen aus Bewirtschaftung und Pacht stammten. Eine bürgerliche Mittelschicht fehlte beinahe vollständig. Die meisten Menschen umfasste die macht- und prestigelose Unterschicht, die in sich allerdings sehr unterschiedlich war: die relativ Armen, die gerade über dem Existenzminimum durch kleinen Besitz oder Erwerbseinkommen mehr oder minder leben konnten (Handwerker, Dienstleister, Händler, Bauern mit geringem Landbesitz); daneben standen die absolut Armen, denen es an den lebenswichtigen Gütern fehlte (Nahrung, Wohnung, Kleidung). Sie (Bauern ohne eigenen Landbesitz, Fischer, Lohnarbeiter, Tagelöhner, Schuldknechte, Sklaven, alleinstehende Frauen, Witwen, Prostituierte) waren auf familiäre und gesellschaftliche Unterstützung angewiesen. Es gab mehr Reiche in den Städten als auf dem Land und umgekehrt mehr Arme in den nichtstädtischen, bäuerlich geprägten Gebieten. Die instabilen Verhältnisse im 1. Jh. n.Chr. verschärften die sozialen Spannungen.
Die Jesus-Gemeinden formierten sich vor allem in den Städten des römischen Reiches und waren bestimmt durch die sozialen Differenzen ihrer Bewohner. Wie z.B. 1 Kor 11,17-34 zeigt, waren die Armen wohl in Mehrzahl, da die Solidarität vor allem ihnen gilt.
Das Lk-Evangelium gilt als „Evangelium der Armen“, weil dort gerade die Armen als Adressaten des heilbringenden Handelns Gottes durch Jesus eine besondere Rolle spielen. Die Glaubensverkündigung in den Gemeinden sah den „Mammon“ in diametralem Gegensatz zur Botschaft Jesu und wird daher nicht müde, die Besitzenden auf ihre Verantwortung für die Armen hinzuweisen, so Lk 12,33:
Verkauft euren Besitz und gebt Almosen! Macht euch Geldbeutel, die nicht alt werden! Verschafft euch einen Schatz, der nicht abnimmt, im Himmel, wo kein Dieb ihn findet und keine Motte ihn frisst!
Wie stark sich die Gemeinden, an die sich das Lukas-Evangelium richtet, in dieser Verantwortung wissen, unterstreicht das Gleichnis vom reichen Prasser und dem armen Lazarus (Lk 16,19-31). Die Fortsetzung des Lukas-Evangeliums in der Apostelgeschichte lässt das sichtbar werden, wenn die Gemeinde in Jerusalem so beschrieben wird: Und alle, die glaubten, waren an demselben Ort und hatten alles gemeinsam. 45 Sie verkauften Hab und Gut und teilten davon allen zu, jedem so viel, wie er nötig hatte. 46 Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Lauterkeit des Herzens (Apg 2,44-46). Das zielt auf ein umverteilendes Handeln zugunsten der Armen. Inwieweit das eine fiktive Utopie der Verfasser war oder ob dieses Ideal wirklich zeitweise praktiziert wurde, ist umstritten. Diese herzliche Offenheit will in den Gemeinden aber jeder Form von materieller und seelischer Armut gelten, was durchaus auch Konfliktpotential enthielt, wie die Bemerkung in Lk 15,1f zeigt:
Alle Zöllner und Sünder kamen zu ihm, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten: Dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen.
Diese zuteilende und Leben ermöglichende Offenheit praktizierten die Jesus-Gemeinden in der Feier des „Brotbrechens“ bzw. des „Herren-mahles“. Im „Teilen“ erfährt die versammelte Gemeinde den in ihrer Mitte gegenwärtigen Christus. Wie ernst es den Gemeinden dabei ist, zeigt deutlich die Mahnung des Paulus an die Gemeinde in Korinth (vgl. 1 Kor 11,17-34).
Auf dem Hintergrund dieses Selbstverständnisses der christlichen Gemeinden des Anfangs ist es nicht verwunderlich, dass Papst Franziskus während seiner ganzen Amtszeit nicht müde geworden ist, darauf hinzuweisen, dass das Antlitz der Kirche auch heute die in Jesus offenbar gewordene Barmherzigkeit widerspiegeln muss, wenn sie den Namen „Kirche Jesu Christi“ für sich in Anspruch nehmen will.
4. Abschließend.
Wenn die Vinzenz-Gemeinschaft sich als Ort der Barmherzigkeit versteht – im Sinne ihres Namenspatrons – dann ist sie, auf dem Hintergrund der vorausgehenden Überlegungen betrachtet, das jesuanische Gesicht der Kirche Jesu Christi vor Ort.